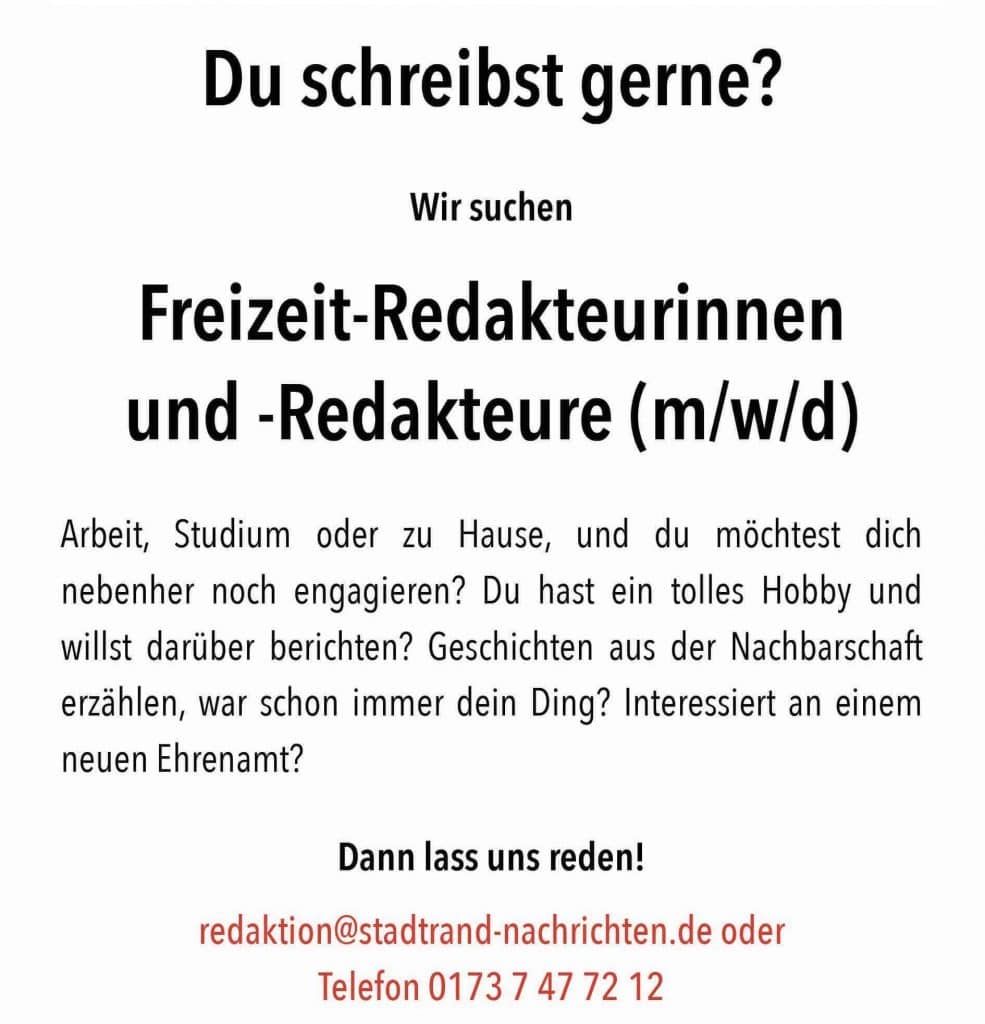Marianne Suhr stellte ihr neues Buch vor. Mit dabei waren Elvira Yevtushenko, die Suhr für das Buch interviewt hatte, und die Vorsitzende der Bürgerstiftung Karin Lau (von rechts). Foto: Gogol
Wie ein Beitrag zur aktuellen Diskussion zu den Themen Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderung war die Benefizlesung der Bürgerstiftung Steglitz-Zehlendorf. Eingeladen in die Gottfried-Benn-Bibliothek war die Autorin und Soziologin Marianne Suhr, die ihr neues Buch “Wir sind angekommen” präsentierte. Darin stellt sie anhand von Interviews 25 Einwanderer und Menschen mit Migrationshintergrund vor, die in Deutschland leben.
Sie habe viele Veranstaltungen zum Thema Integration besucht, auf der ihr immer wieder Statistiken vorgelegt wurden, erzählte Suhr in kleiner, intimer Runde, wie sie die Idee für diese Untersuchung hatte. Vor allem eine Statistik über das Bildungsniveau von Zuwanderern und Deutschen habe sie nachdenklich gemacht und sie den Entschluss fassen lassen, die Migranten selbst zu befragen: Was sie von Deutschland und den Deutschen halten, woher sie kommen, warum sie gekommen sind und wie die erste Zeit in Deutschland für sie war. Befragt hat sie Männer und Frauen, Jugendliche von 15 bis hin zu Senioren von 75 Jahren, Einwanderer aus der Türkei, Polen und der Ukraine, aus Syrien und Afghanistan, aus dem Iran und dem Irak, aus Schottland und aus den USA. Auch Kostas Papanastasiou, bekannt als Wirt aus der Lindenstraße, hat sie befragt. Der zum Beispiel, so berichtet Suhr, kam als Flüchtling aus Griechenland nach Berlin und durfte nicht mehr zurück.
Befragt hat Suhr auch Elvira Yevtushenko, die vor 20 Jahren aus dem Kaukasus nach Berlin kam. Sie war bei der Lesung dabei und erzählte, wie im Interview mit Suhr, wie und warum sie nach Deutschland gekommen ist.
Geboren sei sie 1941 in einer großen jüdischen Familie, in der nach dem Krieg die Männer fehlten, erzählte Yevtushenko. In der Familie sei viel gelesen worden, heimlich, auch verbotene Bücher, es wurde viel am Küchentisch diskutiert. Ihre Gedanken waren frei, während sie in einer Diktatur eingesperrt war. Sie habe gelernt, dass sie besser sein müsse als alle anderen, um ihre Ziele zu erreichen, um beispielsweise zum Studium zugelassen werden, berichtete die Diplom-Physikerin. Sie hatte sich eingerichtet, hatte gelehrt, Kinder bekommen. „Ich habe nie gedacht, dass ich wegfahre“, erinnerte sich die 72-Jährige. Dass sie dann doch fortgegangen ist, sei nicht lange geplant, keine rationale Entscheidung gewesen. Tschernobyl, Perestroika, zunehmender Antisemitismus – „Wir hatten das Gefühl, dass wir wegmüssen“, so Yevtushenko. Den Ausschlag gaben dann der Gorbatschow-Putsch 1991 und die russische Verfassungskrise 1993.
In Deutschland habe sie nicht versucht, sich „anzupassen“, sagte Yevtushenko. „Man muss zuhören und mitmachen“ findet sie. Sie lernte Deutsch – mit 52 Jahren. Statt russisches Fernsehen wie viele andere Auswanderer habe sie deutsches Fernsehen geschaut. Statt den Übersetzungsdienst in Anspruch zu nehmen, habe sie die Anträge zusammen mit ihrem Sohn mit einem Wörterbuch übersetzt. Sie habe verstehen wollen, wie die Menschen hier denken, sie habe die Gemeinsamkeiten gesucht. „Wichtig ist, dass man sich versteht, nicht aus welchem Land man kommt“, davon ist die 72-Jährige überzeugt. Dass sie Sozialhilfe bekam, erinnert sich Yevtushenko, habe sie nicht verstanden. Sie wollte arbeiten für ihr Geld. Und so blieb sie in Berlin, wo sie größten Chancen sah, ein Auskommen zu finden. Heute arbeitet sie noch immer, engagiert sich im Integrationsnetzwerk „Respekt“. Zum einen, weil es ihr Spaß macht, zum anderen aber auch, weil sie bei einer Rente von 216 Euro Geld verdienen muss. Doch sie jammert nicht, das habe sie nie getan, sagt Yevtushenko. Sondern sie habe stets das getan, was nötig sei.
Suhr berichtete von Michael Cullan, der Amerikaner, der sich hin und her gerissen fühlt und sagt, dass er seine Heimat in Charlottenburg gefunden habe; von einem türkischen Ehepaar, dass es nach den politischen Umbrüchen im Herkunftsland genießt, zwischen Deutschland, wo die Freunde leben, und der Türkei, wo die Familie lebt, pendeln zu können; von einer syrischen Mutter, modern gekleidet und ohne Kopftuch, die als Schwiegertochter lieber ein Mädchen „aus der Heimat“ hätte.
Was Suhr besonders beeindruckte, war, dass ihre Interviewpartner „ohne Selbstdarstellung“ von ihrem Leben berichtet hätten und dass diese 25 Menschen bereit gewesen waren zurückzugehen in „eine Zeit, die nicht schön war, denn alle hatten Gründe wegzugehen.“
(go)