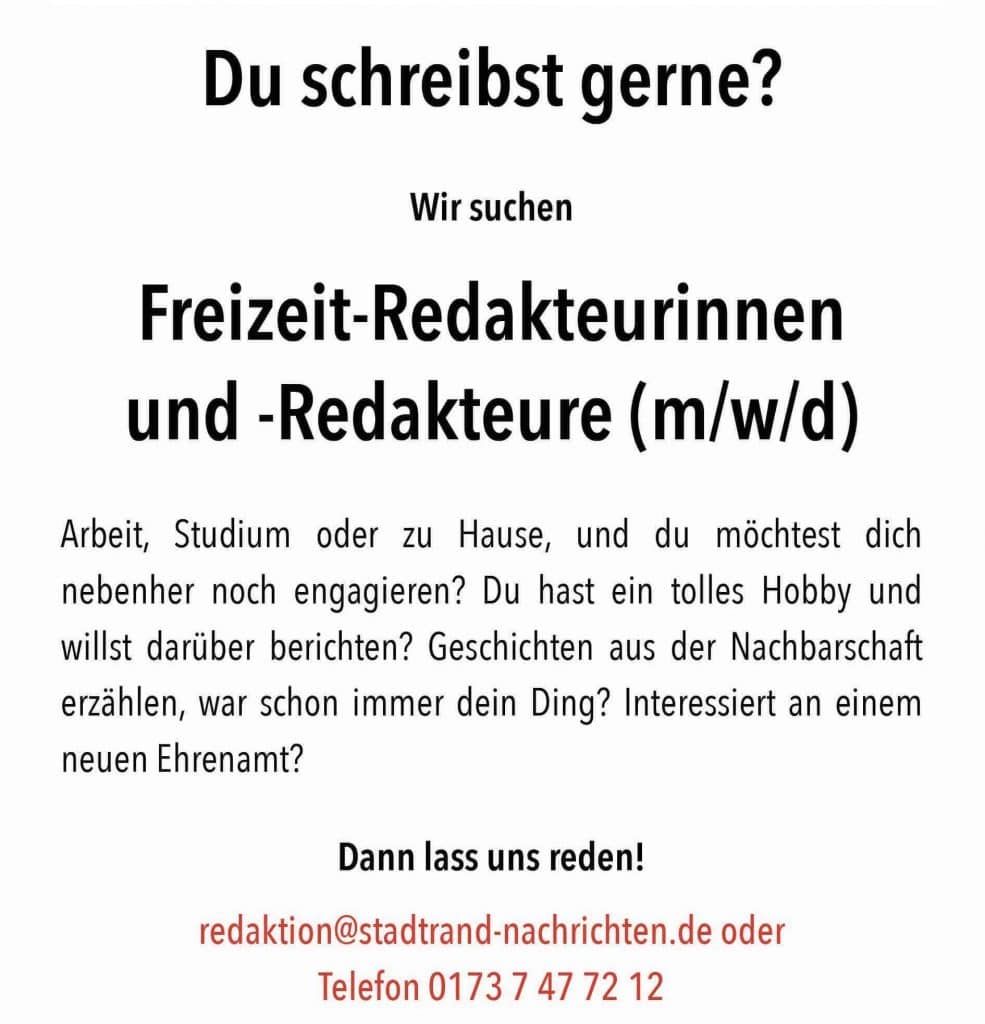Katja Boguth ist Professorin für Pflegewissenschaften an der Alice Salomon Hochschule. Die Forscherin warnt vor einem Personalmangel in den Pflegeberufen und mahnt Konzepte an. Die gelernte Kinderkrankenschwester und Krankenschwester kennt den Umgang mit hilfebedürftigen Menschen aus ihrer langjährigen Berufserfahrung. Foto: Alice Salomon Hochschule Berlin
Im Interview mit den Stadtrand-Nachrichten erklärt Pflegewissenschaftlerin Katja Boguth, welche Auswirkungen der demografische Wandel haben wird und wieso sofortiger Handlungsbedarf besteht. Dabei zeichnet sie eindrückliche Bilder, welche Folgen ein bloßes „Weiter wie bisher“ haben könnte. In ihrem Garten in Lichterfelde, das Universitätsklinikum Benjamin Franklin in Sichtweite, spricht sie über die anstehende lückenhaft geplante Krankenhausreform, formuliert Forderungen an die Politik und beschreibt die Notwendigkeit einer neuen solidarischen Gesellschaft (wir berichteten darüber).
Stadtrand-Nachrichten: Frau Boguth, Karl Lauterbach plant eine umfassende Krankenhausreform. Wird jetzt alles besser in der Pflege?
Boguth: Die Aufteilung von Krankenhäusern in Spezialzentren einerseits und Krankenhäuser mit einer Basisversorgung andererseits halte ich für richtig. Durch die Spezialisierung ergeben sich Kompetenzzentren, was die Qualität der medizinischen Versorgung verbessern wird. Gleichzeitig wird durch den damit verbundenen Wegfall von Kliniken erfahrenes und kompetentes Personal „freigesetzt“, so dass in den übrigen Kliniken der Personalschlüssel erhöht werden kann. Belastungen für das Personal könnten reduziert und die Patient_innensicherheit erhöht werden.
Stadtrand-Nachrichten: Dennoch scheinen Sie nicht zufrieden. Was fehlt Ihnen bei den Plänen von Gesundheitsminister Lauterbach?
Boguth: Was bei dieser Reform nicht mitgedacht wurde, ist die Frage, wie Betroffene und ihre Angehörgen chronische Krankheit und Pflegebedürftigkeit besser bewältigen können. Die Krankenhausreform ist aus der Perspektive der Medizin gedacht, die pflegerischen Bedarfe von Menschen wurden nicht ausreichend berücksichtigt.
Nun kommen weitere gesellschaftliche Entwicklungen hinzu: Die Anzahl an Menschen mit Pflegebedarf wird sich deutlich erhöhen. Gleichzeitig wird mehr als ein Drittel der aktuell tätigen Pflegefachkräfte in den nächsten zehn Jahren altersbedingt den Beruf verlassen. Verlässliche Pflegepersonalstatistiken gibt es dazu nicht, aber so schätzen die Berufsverbände die Austritte ein. Die Bereiche der Akut- und Langzeitpflege konkurrieren um immer weniger Pflegefachpersonen.
Pflegebedürftigkeit lässt sich nicht heilen wie manche Krankheit, sondern sie ist dauerhaft vorhanden. Es geht also um die Sicherstellung einer stabilen Langzeitversorgung. Ich habe das Gefühl, dass unsere Gesellschaft dieses Problem noch nicht erkannt hat oder die Augen davor verschließt. Unsere Generation ist an eine Vollversicherung im Krankheitsfall gewöhnt und glaubt, dass es so auch im Pflegefall sein wird. Aber dem ist nicht so. Deshalb ist es wichtig, sich jetzt mit der Frage zu konfrontieren: Wer pflegt mich eigentlich, wenn ich selber dazu nicht mehr in der Lage bin? Wir können schon jetzt nicht mehr davon ausgehen, dass es reicht, das Telefon in die Hand zu nehmen und einen ambulanten Pflegedienst oder einen Platz in einer Pflegeeinrichtung zu erhalten. Lange Wartezeiten führen zu großer Verzweiflung in den betroffenen Familien und diese Situation wird sich verschärfen.
Gleichzeitig sind Nachbarschaftshilfe und Solidarität sehr wichtige gesellschaftliche Werte, die eine wichtige Ressource darstellen, die unserer Gesellschaft aber ein wenig abhandengekommen sind. Sie müssen gestärkt werden, damit wir die „Pflegekrise“ meistern können
Stadtrand-Nachrichten: Sehen Sie dafür schon Ansätze?
Boguth: In der Corona Pandemie sah ich das. Viele Menschen haben sich um Familienangehörige aber auch um Nachbarn gesorgt, an der Tür geklingelt und ihre Hilfe angeboten. Dieser Blick über das eigene Leben und die eigenen Bedürfnisse hinaus ist aber mit der Zeit leider wieder verlorengegangen.
Die drohende Pflegekrise wird voraussichtlich die Gesellschaft vor weitere Herausforderungen stellen, es wird nicht nur darum gehen, einen Einkauf für jemanden anderen zu erledigen, sondern auch darum, einer anderen Person bei der Körperpflege behilflich zu sein.
Stadtrand-Nachrichten: Nachbarschaftshilfe und Körperpflege?
Boguth: Ich glaube, dass wir es uns in Zukunft nicht aussuchen können. Es wird zu Situationen kommen, in denen eine verwirrte ältere Person vor der Wohnungstür steht und klingelt. Oder dass sich Menschen auf der Straße befinden, die desorientiert sind, die den Verkehr blockieren, die im Einkaufsladen schreien, weil sie nicht wissen, wie sie da wieder herauskommen.
Das hat Auswirkungen auf unseren Alltag, diese „Zwischenfälle“ werden sich wie Sand im Getriebe verhalten. Wir werden sie nicht ignorieren können.
Stadtrand-Nachrichten: Die Versorgung von heute wird es in 20 Jahren nicht mehr geben?
Boguth: Wir können schon heute nicht jedem, der pflegebedürftig ist, eine Pflegeperson an die Seite stellen. Dann müsste schon jetzt jede_ vierte Schulabgänger_in den Pflegeberuf erlernen. Und so ist der Beruf auch nicht gedacht. Es ist und es bleibt eine Aufgabe in der Familie und anderer Bezugspersonen.
Erschwerend kommt die Individualisierung der Gesellschaft hinzu: Wir haben immer mehr Single Haushalte und Frauen, die früher in der traditionellen Rollenverteilung die Care-Arbeit übernommen haben, sind erwerbstätig und die eigenen Kinder leben oft nicht mehr in derselben Stadt oder demselben Land wie die Eltern. Ich denke, die Politik lässt diese Entwicklung gerade einfach laufen.
Stadtrand-Nachrichten: Womit könnte man denn anfangen?
Boguth: Meines Erachtens müssten grundlegende Gesundheitskompetenzen bereits in den Schulen vermittelt werden, zum Beispiel in einem Schulfach. Dazu zählen neben der Säuglingspflege, Kenntnisse über Notfallversorgung, gesundheitsförderndes Verhalten und Hygiene. Früher wurde dieses Wissen generationsübergreifend weitergegeben, aber diese „Anlernsituationen“ werden seltener, weil die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sich geändert haben.
Stadtrand-Nachrichten: Das wäre ein langfristiger Plan. Was müssten Verantwortliche in der Gesundheitspolitik jetzt und heute tun?
Boguth: Aufklärung ist wichtig. Die Senatsverwaltung hat in der letzten Legislatur einen Bürgerdialog und eine Imagekampagne zur Pflege auf den Weg gebracht, das war ein guter Ansatz. Das Thema muss direkt in die Gesellschaft, in die Kieze. Sich um andere zu sorgen, kann eine sehr schöne und erfüllende Aufgabe sein.
Care Arbeit muss außerdem mehr Anerkennung erfahren, und es darf nicht sein, dass die Menschen, die diese Arbeit erbringen, benachteiligt sind, z.B. weil sie ihre Berufstätigkeit reduzieren oder gar aufgeben müssen. Auch Männer sollten sich angesprochen fühlen, sie stellen eine große Ressource dar.
Stadtrand-Nachrichten: Sollten Menschen verpflichtet werden, sich für eine bestimmte Zeit sozial zu engagieren?
Boguth: Das kann eine Lösung sein. Wir müssen kreativ darüber nachdenken, wie wir dieses Problem in den Griff bekommen. Wir müssen Lösungen finden, nicht erst, wenn Menschen sterben, weil sie nicht ausreichend versorgt werden. Es ist eine Frage der Sensibilisierung und des Trainings bestimmter Maßnahmen. Schon heute ist nachbarschaftliche Unterstützung gefragt, zum Beispiel wenn sich ältere Menschen und junge Kinder an heißen Tagen in Gefahr bringen, weil sie nicht ausreichend trinken. Wassermangel kann zu einer akuten Verwirrtheit und zu Störungen im Gleichgewicht führen, damit erhöht sich die Sturzgefahr, Stürze wiederum führen zu Überlastungen in den Notfallaufnahmen.
Wie groß wird unsere Betroffenheit sein, wenn wir erfahren, dass in der direkten Nachbarschaft eine alleinstehende gebrechliche Person verdurstet ist, während man selbst zu Hause war und Serien im Streaming schaute. Wenn jemand stirbt, weil niemand wusste, dass hier nachbarschaftliche Hilfe erforderlich war.
Stadtrand-Nachrichten: Was kann Politik konkret tun?
Boguth: Neben Aufklärungskampagnen finde ich das Konzept der Community Health Nurses relevant. Das sind hochschulisch qualifizierte Pflegefachpersonen, die beispielsweise im öffentlichen Gesundheitsdienst arbeiten und bezogen auf eine festgelegte Postleitzahl ihre „Community“ haben. Damit haben sie einen Überblick über die Einwohnerstruktur anhand von Melderegisterdaten im Kiez, so lassen sich vulnerable Situationen schnell aufspüren. Die Community Health Nurses führen in der Regel die Pflege nicht selbst durch, sondern sind zum Beispiel erste Ansprechpersonen für Menschen mit chronischen oder Mehrfacherkrankungen, Behinderung oder Pflegebedarf. Sie unterstützen auch Laien-Pflegende indem sie ein individuelles Hilfenetzwerk aufbauen. Sie können in Not- und Katastrophenlagen schnelle Hilfen organisieren. Sie vernetzen potentielle Unterstützungssysteme im Kiez und binden dabei zum Beispiel religiöse Institutionen, die Polizei, Wohnungsbaugenossenschaften, oder Vereine ein. Community Health Nurses stehen auch in engen Kontakt zu Hausärzten im Kiez. Es handelt sich um eine aufsuchende Struktur, die auch präventiv agiert.
Stadtrand-Nachrichten: Gibt es solche Ansätze in Deutschland oder in Berlin schon?
Boguth: Ja, sehr vereinzelt, beispielsweise das Gesundheitskollektiv in Neukölln im Rollberg-Kiez. Dort sind Pflegefachpersonen mit solchen Aufgaben betraut. Ein positives Beispiel ist das Bundesland Rheinland-Pfalz. Dort gibt es seit mehreren Jahren eine Pflegeberufekammer und es existiert eine Versorgungstruktur in der primären Versorgung, die sich Gemeindeschwester Plus nennt. In Abstimmung mit der Ärztekammer arbeiten Pflegende und Hausärzte Hand in Hand. Dieses Konzept kommt der Community Health Nurse schon sehr nahe. In der Corona-Pandemie hat sich ein weiterer Nutzen der Kammer darin gezeigt, dass durch den direkten Kontakt zur Berufsgruppe der Pflegefachpersonen sehr schnell effiziente Hilfestrukturen aufgestellt werden konnten. Die Daten, die dort über die größte Berufsgruppe im Gesundheitswesen vorhanden sind, gibt es für Berlin nicht. Es gibt in Berlin keine amtliche Statistik darüber, wer in diesem Beruf in welchem Umfang arbeitet, welche weiteren Fachqualifikationen vorhanden sind und wann die Person in Rente gehen wird. Wir tappen hier ziemlich im Dunkeln.
In einer Kammer sind alle Angehörigen der Berufsgruppe Pflichtmitglied, die somit auch alle direkt angesprochen werden können. In Berlin funktioniert das nur über die Träger der Einrichtungen, in denen Pflegende arbeiten. Eine Kammer würde die Qualität des Berufsstandes durch eine Verpflichtung sich regelmäßig fortzubilden und durch Beschwerdestellen erhöhen.
Stadtrand-Nachrichten: Das hieße dann auch mehr Verantwortung.
Boguth: Dass ein Arzt oder eine Ärztin hierzulande Pflege verordnen muss, ist doch völliger Irrsinn. Oft können Pflegefachpersonen besser beurteilen, ob jemand Unterstützung benötigt und in welcher Form. Sie sollte Hilfsmittel verordnen können, und Beratungsleistungen sowie das Anlernen von Laien und Weiterbilden von Kollegen sollte als Leistung abrechenbar sein. Sozialpflegerische Aspekte wie Einsamkeits-Prävention gehören auch dazu. Derzeit wird alles in Deutschland aus der ärztlich-medizinischen Perspektive gedacht und da fehlt einfach ein Teil.
Stadtrand-Nachrichten: Noch einmal zurück zu uns allen, Stichwort „Solidarische Gesellschaft“. Wie kommen wir da hin?
Boguth: Jeder Sterbeprozess ist verbunden mit einer vorherigen Pflegebedürftigkeit. Dieser Zeitraum dauert unterschiedlich lange und bewegt sich zwischen vier Monaten und zwei Jahren. Wenige sind vor ihrem Tod nicht pflegebedürftig, manche viele Jahre lang. Fakt ist: Das Thema betrifft alle. Wer als Hochbetagter Unterstützung erwartet, sollte sich vorher selbst um jemanden gekümmert haben. Dafür braucht es Beratung und Strukturen. Nachbarschaftliche Strukturen sollte man auch in der Stadtplanung mitdenken.
In einigen Städten gibt es den sogenannten „dritten Ort“ als Ergänzung zum ersten und zweiten Ort, dem Zuhause und dem Arbeitsplatz. Er dient als Ausgleich und ist Treffpunkt für die nachbarschaftliche Gemeinschaft. Im Gegensatz zu den anderen ist der dritte Ort offen zugänglich, inklusiv und neutral. Der Kontakt zwischen Bürgern wird hier gefördert, der soziale Zusammenhalt gestärkt und das demokratische Leben angeregt. Das sind nicht nur die oft genannten Bibliotheken, sondern können auch Arztpraxen, Bürgeramter, Einkaufszentren, Cafés, Parkanlagen, Kinderspielplätze, oder ein Theater sein. Diese schönen Orte wirken wie Magneten auf Menschen. Begegnung und Gespräch sind immer ein guter Anfang.
Die Fragen stellten Junia Greb-Georges und Daniela von Treuenfels
Einen Kommentar zum Interview lesen Sie hier
Hier geht es zum Bericht zum Thema Zukunft der Pflege